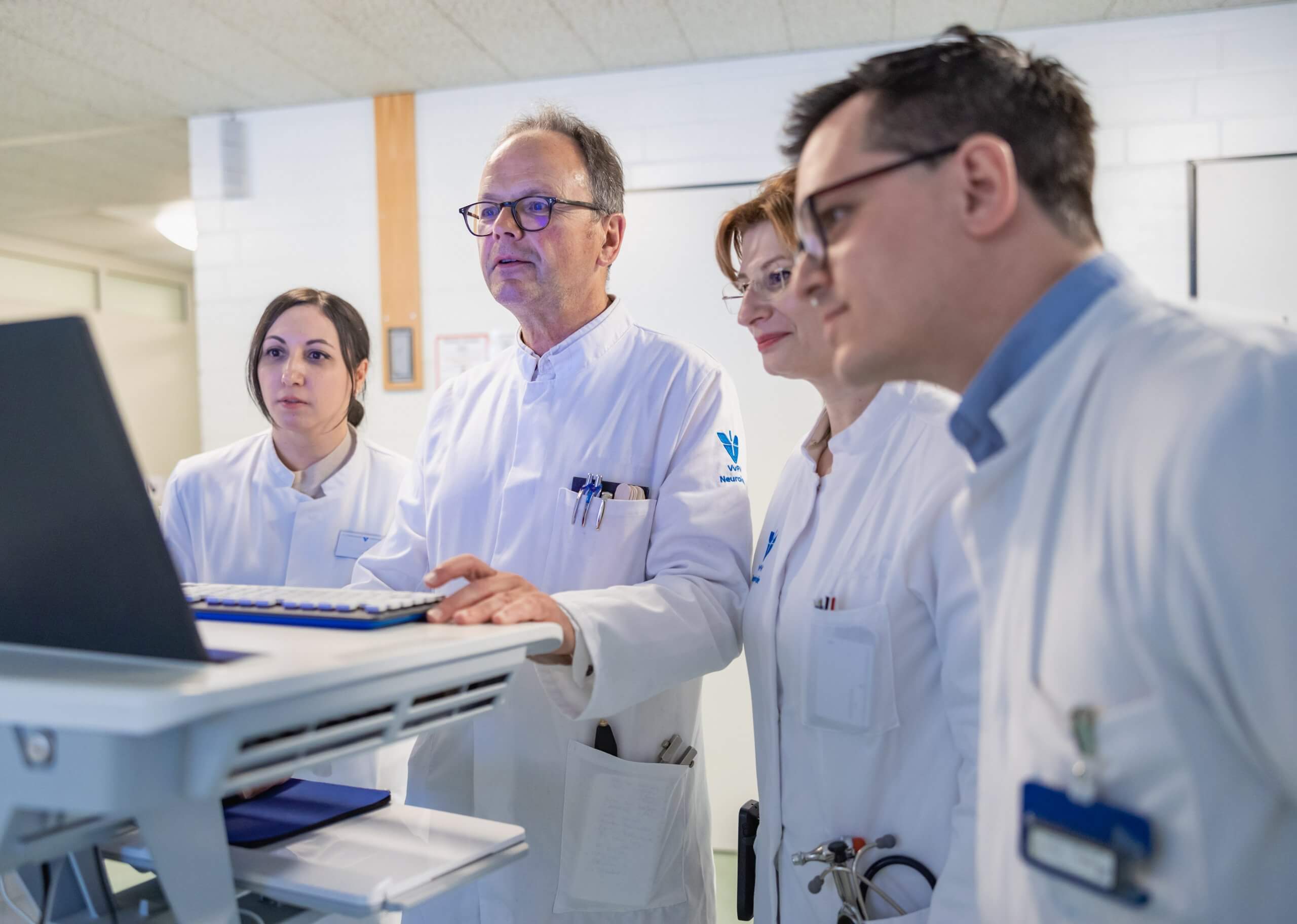Arbeiten kann die beste Reha sein

Pro Jahr erhalten in Deutschland zirka 126.000 Menschen die Diagnose Parkinson. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 55 Jahren. Bei den 60-Jährigen sind ein Prozent und bei 80-Jährigen 15 Prozent betroffen. Zirka zehn Prozent haben eine familiäre Häufung. Chefarzt Dr. Klaus Demuth sieht gute Chancen für ein Leben mit Morbus Parkinson.
Herr Dr. Demuth, können Betroffene eine beginnende Erkrankung erkennen?
Typische Beschwerden werden meist erst verzögert wahrgenommen. Man muss bedenken, dass Parkinson-Symptome oft eine völlig andere Ursache haben, man nennt diese sekundäre Parkinson-Syndrome. Der Morbus Parkinson ist die Erkrankung, die man unter Parkinson versteht und über die wir hier reden. Dieser lässt sich im Gegensatz zu den anderen in den ersten zehn Jahren sehr gut mit Medikamenten behandeln. Beim Morbus Parkinson sterben die Zellen ab, die das Dopamin bilden.
Welche Symptome sind denn typische Anzeichen?
Die Hauptsymptome sind das Ruhezittern, Bewegungsarmut und Muskelsteifigkeit. Auch Angehörige erkennen die Veränderung nicht so schnell, weil es ein schleichender Prozess ist. Beim Morbus Parkinson müssen zirka 50 Prozent der Zellen untergegangen sein, bis äußerliche Auffälligkeiten erkennbar sind. Werden Patienten gründlich untersucht, lassen sich etwas früher Merkmale diagnostizieren. Eine Früherkennung ist natürlich optimal. Allerdings gibt es bisher keine Medikamente, die den Parkinson schützend aufhalten.
Lässt sich der Prozess der Erkrankung verlangsamen?
Leider nicht. Man behandelt nach wie vor die Symptome. Aber wie bei anderen Krankheiten auch, kann man durch Bewegung und einen gesunden Lebensstil die Erkrankung und deren Entwicklung günstig und positiv beeinflussen.
Was sind die ersten Schritte bei Anfangsverdacht?
Die richtige Diagnose muss von einem Facharzt gestellt werden, damit eindeutig erkannt wird, mit welcher Art Parkinson der Patient zu tun hat. Erst dann kann die richtige Therapie empfohlen werden. Man muss trennen können, ob es sich um einen Morbus Parkinson oder einen atypischen Parkinson handelt, auch wenn gleiche Symptome vorhanden sind. Wichtig ist zu wissen, was die Ursache ist. Beim Morbus Parkinson gehört dazu, dass Betroffene gut auf das Dopamin ansprechen.
Mit welchen Verfahren können Fachärzte eine gesicherte Diagnose stellen?
An erster Stelle sind eine Computertomografie (CT) und/oder Magnetresonanztomographie (MRT) für eine Differenzialdiagnose hilfreich. Informationen kann auch ein sogenanntes SPECT – das ist ein nuklearmedizinisches Verfahren – geben, das direkt anzeigt, wie viel Dopamin ausgeschüttet wird, also wie viele Zellen schon untergegangen sind. Man muss nicht alles bei jedem Patienten anwenden. Nur wenn man im Zweifel ist, ermöglichen alle drei eine sichere Diagnose.
Was folgt, wenn der Befund eindeutige Hinweise auf Morbus Parkinson gibt?
Das ist zum einen die medikamentöse Therapie und zum anderen die Physiotherapie und Ergotherapie. Mitunter ist auch eine Logopädie wichtig, wenn die Stimme leise wird und Schluckstörungen auftreten. Die Chance einer Mehrfachverordnung haben die Patienten auf jeden Fall.
Haben Patienten nach der Diagnose eine Chance, ihr Leben mit der Erkrankung zu gestalten? Selbstverständlich, bei richtiger Diagnose gibt es eine Reihe sehr guter Medikamente und in Einzelfällen auch operative Verfahren. Im Schnitt können Betroffene ein völlig normales Leben in den kommenden zehn Jahren führen und meistens auch bis zu 20 Jahre danach gut bis ausreichend behandelt werden. Natürlich haben Medikamente Nebenwirkungen. Der Abbauprozess geht ja weiter und das bedeutet, es gehen immer mehr Zellen kaputt und die Patienten benötigen immer stärkere Medikamente. Da sind dann auch mal Grenzen gesetzt. Aber die Lebenserwartung ist nicht unbedingt herabgesetzt. Ich kenne Patienten, die weitergearbeitet haben, obwohl sie hätten längst in Rente gehen können. Und genau von denen weiß man, dass sie von ihrer Motivation und positiven Lebenseinstellung profitieren. Arbeiten und eine Struktur im Alltag beeinflussen die Erkrankung sehr positiv. Ich sage immer: Arbeit ist die beste Reha. Wenn ich eine Aufgabe habe, setze ich alle meine Gliedmaßen so ein, wie ich es brauche. Trotz körperlicher Einschränkung kann man mit Parkinson prinzipiell alles machen. Es sollte allerdings nicht zu Fehlbelastungen führen.
Können Sie dazu Beispiele geben?
Ja, in der Physiotherapie beispielsweise wird auch eine Gangschulung angeboten. Natürlich sind die Menschen eingeschränkt, aber auch das lässt sich kompensieren, zum Beispiel mit Walkingstöcken oder auch einem Rollator. Damit kann man ja trotzdem laufen, obwohl Parkinsonpatienten sturzgefährdet sind. Wenn man darauf Rücksicht nimmt und trotzdem läuft, ist es besser als sich nur noch hinzusetzen. Zum Leben mit Parkinson kann auch ein Ehrenamt gehören. Hat man Arbeit, ist man nicht allein und hat zudem ein höheres Selbstwertgefühl. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt. Oft haben Betroffene eine gewisse Scheu, mit ihrer Behinderung in der Öffentlichkeit umzugehen. Hat man Kontakte und arbeitet noch – was auch immer –, dann verliert man diese Angst. Dann sehen andere den Menschen mit Parkinson und nicht den Behinderten. Jeder Mensch, egal welche Krankheit er hat, hat das Recht auf seine Persönlichkeit und das auch mit einer Krankheit. Wenn man gar nicht mehr kann, ist es wieder etwas Anderes. Aber man sollte alles versuchen, um einem normalen Leben nachzugehen.
Sollte das Thema Sturz besonders berücksichtigt werden?
Das Leitsyndrom ist die mindere Bewegung mit einem kleinschrittigen Gang. Patienten können nicht mehr schnelle Ausgleichsschritte machen. Beim Stolpern kann die Balance nicht schnell ausgeglichen werden und ein Sturz ist die Folge. Das kann durch Gehschulungen geübt werden. Man darf nicht den Fehler machen und das Handicap verdrängen, sondern eine wichtige Aufgabe für Parkinson-Patienten ist tatsächlich, mit dem Handicap umzugehen. Oft entwickeln Patienten Eigenstrategien, um Einschränkungen ausgleichen zu können.
Stichwort Angehörige: Können sie durch übertriebene Fürsorge mehr Schaden anrichten?
Partner sind immer mit betroffen. Selbsthilfegruppen bieten einen guten Austausch untereinander. Patienten sollten möglichst viel Freiraum haben. Überforderung kann den Zustand verschlechtern. Angehörige brauchen Geduld und müssen auch mal alte Rituale über Bord werfen. Ganz wichtig ist Vertrauen.
Möchten Sie noch eine wichtige Botschaft an Betroffene geben?
Ich rate allen, vieles selbst in die Hand zu nehmen, vielleicht auch mal eigenes Geld einzusetzen. Zum Beispiel ist Fahrradfahren daheim auf einem Ergometer sehr hilfreich. Das größte Problem ist das Auf- und Absteigen. Die Bewegung geht besser, wenn man beim Treten einen Rhythmus findet.
Es mag etwas merkwürdig klingen, ist aber aus Erfahrungen richtig: Machen ist bei Morbus Parkinson ein wichtiger Bestandteil der Medizin.
Vinzenz von Paul Hospital gGmbH
78628 Rottweil
Telefon (0741) 241-0
neurologie@vvph.de
www.vvph.de